
Einkommens- und Vermögensschutz durch die Pflegeversicherung? Eine finanzwissenschaftliche Fallbetrachtung
WIP-Kurzanalyse Oktober 2025
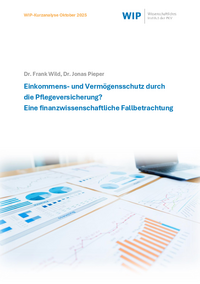
Eine pauschale Begrenzung der Eigenanteile in der stationären Pflege – etwa durch einen „Pflegekosten-Deckel“ – ist aus finanzwissenschaftlicher Sicht teuer, ineffizient und ungerecht. Eine solche Leistung erzeugt Mitnahmeeffekte bei Personen, die diese Leistungen selbst tragen können. Sie wirkt wie ein umlagefinanziertes Erbenschutzprogramm, belastet die Solidargemeinschaft und schwächt die Eigenverantwortung.
Studien zeigen: Insgesamt sind 71,9 Prozent der Rentnerhaushalte in der Lage, bis zu fünf Jahre stationäre Pflege vollständig aus eigenem Einkommen und Vermögen zu finanzieren. Rentnerinnen und Rentner verfügen über mehr Vermögen als jüngere Jahrgänge. Der Blick auf das reine Renteneinkommen springt zu kurz, im Durchschnitt stammen nur 53 Prozent aller den Rentnerhaushalten zufließenden Einkommen aus der Gesetzlichen Rentenversicherung. Im Durchschnitt verfügen Rentnerhaushalte über ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen von 3.759 Euro (Paare), 2.213 Euro (alleinstehende Männer) bzw. 1.858 Euro (alleinstehende Frauen). Ein weiteres Indiz für die gute Vermögenslage: Die durchschnittliche Höhe von Erbschaften beläuft sich auf etwas mehr als 85.000 Euro pro Person.
Ein Pflegekosten-Deckel von 1.000 Euro pro Monat würde die Ausgaben der sozialen Pflegeversicherung im Einführungsjahr um rund 9,2 Milliarden Euro erhöhen. Würden die einrichtungseinheitlichen Eigenanteile komplett von der Pflegeversicherung übernommen, würde dies jährliche Mehrausgaben von mindestens 16,3 Milliarden Euro bedeuten, bei steigender Tendenz in den Folgejahren.